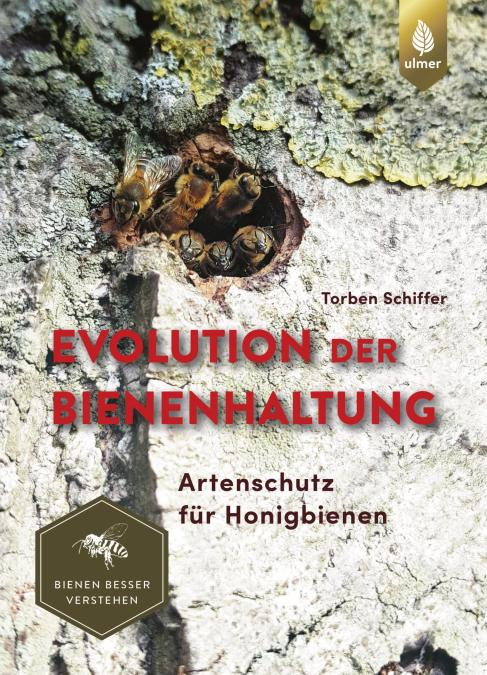Um das Nutztier Honigbiene ging es im letzten Podcast und Blog. Hier folgt nun − wie angekündigt – die Episode zum »Wildtier Honigbiene«. Wieso Wildtier? Gibt es Apis mellifera, die Westliche Honigbiene, überhaupt noch wild lebend bei uns? Sagen die Imker nicht immer, dass unsere Honigbienen nicht mehr ohne ihre Hilfe überleben könnten, seit wir die Varroamilbe hierher eingeschleppt hätten. Wobei es die Imker selbst sind, die dafür verantwortlich gemacht werden, dass die von der Asiatischen Honigbiene stammenden Parasiten jetzt auch unseren Bienenvölkern zusetzen. Der weltweite Handel mit Bienenköniginnen, und teilweise auch ganzen Völkern, hat’s möglich gemacht. Und er soll das Überleben der Bienen ohne imkerliche Hilfe unmöglich gemacht haben.
Die gute Nachricht: Die wildlebende Honigbiene ist mitnichten ausgestorben. Apis mellifera kann auch ohne Imkerin oder Imker überleben – trotz Varroabefall. Vorausgesetzt, ein schwärmendes Bienenvolk findet eine geeignete Nisthöhle, am besten einen hohlen Baum, den der Specht und andere Vorbesitzer bereits vorbereitet haben. Das wäre der natürliche Wohnraum der Honigbiene. Nur finden sich in unseren bewirtschafteten Wäldern kaum noch hohle Bäume.
Also müsste es wohl ein Artenschutzprogramm geben, das wildlebenden Honigbienenvölkern Wohnraum schafft. Und genau das gibt es. Für diese Ausgabe des Blogs und des Podcasts habe ich einen Bienenforscher besucht, der sich dem Artenschutz von Honigbienen verschrieben hat.
Artenschutz für Honigbienen
»Ich halte keinen Bienen, sondern ich bin Artenschützer«, sagt Torben Schiffer über sich. Er stellt artgerechten Wohnraum zur Verfügung: Nachbauten der natürlichen Baumhöhlen, die es nicht mehr gibt. Und dann, wenn die Bienen in seinen Schiffertree eingezogen sind, beobachtet er die natürlichen Prozesse. Er ist also kein Imker – mehr. Das war er einmal, sagt Torben Schiffer. Er sei über seine wissenschaftliche Arbeit an und mit den Bienen davon abgekommen. Noch im Biologiestudium sei er ein ganz normaler Imker gewesen, mit Kunststoffkästen für seine Völker und Säurebehandlung gegen die Varroamilbe. So beschreibt er das auch in seinem Buch »Evolution der Bienenhaltung«, das er dem »Artenschutz für Honigbienen« gewidmet hat.
Dabei geht er der Frage nach, wie unsere Honigbienen als Wildtiere überleben können, trotz der aus Asien eingeschleppten Varroamilbe.

Der Anfang eines neuen Bienenvolkes ist natürlicherweise der Schwarm. In einem existierenden Bienenstock hat das Volk begonnen, neue Königinnen heranzuziehen. Dazu werden besonders große Zellen für die Larven angelegt und diese mit besonderem Futter gepäppelt. Kurz bevor die junge Königin dann schlüpft, kommuniziert sie aus der Wabenzelle heraus mit der alten Königin des Stocks. Die macht sich daraufhin mit einem Teil des Volkes auf und fliegt hinaus. Das aber, sagen viele Imkerinnen und Imker, ist ihr sicherer Tod, denn der Schwarm nimmt die Milben mit, die sie ohne die Hilfe von Imkerinnen und Imkern umbringen werden.
Das sieht der Bienenforscher Torben Schiffer anders. Und er beruft sich dabei auf die von ihm eigentlich eher verächtlich »Zooforscher« genannten Bieneninstitute, die nur am Nutztier Biene forschen, nicht am Wildtier. Das hessische Bieneninstitut Kirchhain hat aber einmal untersucht, was mit dem Bienenparasiten Varroamilbe geschieht, wenn ein Volk schwärmt und ein anderes nicht. Ergebnis: In der Bienenkiste, in der die Forschungsimker den Schwarmtrieb durch Töten der jungen Königinnen unterdrückten, war am Ende des Sommers die Dichte der Varroamilben so hoch, dass das Volk ohne die imkerliche Behandlung mit verdampfter Säure den Winter nicht überlebt hätte. In der Kiste, aus der ein Teil des Volkes wegschwärmen durfte, war der Befall mit Varroa aber unterhalb der letalen Dosis.
Natürlicher Milbenschutz
Das lässt sich leicht erklären, wenn man den Lebenszyklus der Honigbiene und den ihres eingeschleppten Parasiten kennt. Wenn aus einem Bienenstock die alte Königin mit einem Teil des Volkes ausgeflogen ist, schlüpft die neue Königin und macht sich erst einmal auf zu ihrem Hochzeitsflug. Dabei lässt sie sich von möglichst vielen Drohnen aus verschiedenen Völkern begatten, wenn die Imker das nicht aus Gründen der Zucht verhindern.
Ist die neue Königin dann zurück in ihrem Stock, beginnt sie aber nicht sofort mit der Eiablage. Vier Wochen währt die Brutpause in einem Bienenvolk mit neuer Königin. Vier Wochen lang können deshalb die parasitischen Milben auch keine Eier legen, weil die nur an den Bienenlarven in den verdeckelten Wabenzellen gedeihen.
Während der Brutpause ihres Wirtstieres werden die Varroamilben unfruchtbar, sie verfallen in eine nicht-vegetative Phase, in der sie zwar weiterleben, aber keine Eier mehr legen können. Wenn dann nach vier Wochen neue Bienenlarven entstehen, werden die zwar wieder von den Milben befallen. Die brauchen dann aber noch einmal einen ganzen Entwicklungszyklus, um nachzuwachsen. Dann reicht den Parasiten die Zeit bis zum Winter nicht mehr, um zu einer für die Bienen tödlichen Dichte heranzuwachsen.
Das Fazit aus dieser Beobachtung: »Die Imker müssten ihren Bienenvölkern nur gestatten, sich natürlich zu vermehren, schon wäre die Varroamilbe von einem tödlichen Problem zu einer lästigen Plage geschrumpft«, sagt Torben Schiffer. Aber selbst diese Erkenntnis aus der Forschungsarbeit eines der eigenen Institute werde von den Imkerverbänden weitgehend ignoriert. Der Grund: »Ein weggeflogener Schwarm verringert den Honigertrag. Eine von irgendwelchen dahergeflogenen Drohnen frei begattete Königin passt nicht zu den Zuchtzielen, das Ganze also nicht ins Konzept.“

Unnatürliche Turbobienen
Zum Konzept gehört auch, dass die professionelle Imkerei stetig bemüht ist, ihre Nutztiere immer im Turbomodus zu halten. Deshalb wird immer dann, wenn in den aus aufeinandergesetzten Kistenteilen bestehenden Bienenbeuten ein Brutraum voll ist oder ein Honigraum, eine neue Kiste aufgesetzt – und der Nistplatz und der Vorratsraum des Bienenvolkes ins Unnatürliche oder sogar Übernatürliche vergrößert. Das bedeutet Stress für die Bienen – und am Ende ein deutlich verkürztes Leben.
Torben Schiffer nennt das eine »künstliche Notstandshaltung«. Durch immer neu aufgesetzte Honigräume wird den Bienen suggeriert, sie hätten nicht genug Vorrat. Also fliegen sie aus und suchen Nektar, um Honig zu produzieren. »Man hält sie ständig in ihrem ersten Instinkt gefangen: der Vorratshaltung. Und dieser Modus bedeutet Verschleiß.« Eine Sammelbiene kann nur etwa zwei Gramm Nektar eintragen. Danach ist sie verschlissen und stirbt. Im Turbomodus lebt sie dann nur rund fünf Tage. Entsprechend viele Bienen sterben jeden Tag, und entsprechend viele Eier muss die Königin nachlegen.
Torben Schiffer rechnet vor: »Die Königin kann bis zu zweitausend Eier am Tag legen. In einer Baumhöhle, der natürlichen Behausung eines Bienenvolkes, wäre sie damit nach zwei Tagen durch, denn dann wäre da kein Platz mehr.« In einer Bienenbeute aber kann die Imkerin oder der Imker allein den Brutraum auf die doppelte Größe einer Baumhöhle anwachsen lassen.
In der ursprünglichen Behausung eines Bienenvolkes wird der Brutraum im Laufe des Sommers nicht vergrößert, sondern zugunsten des Honigvorrats geschrumpft. In den Turbomodus des Sammelns verfallen die Bienen in einer Baumhöhle oder in dem ihnen stattdessen angebotenen Schiffertree nur im Frühjahr. Wenn dann der erste Stress vorüber ist und das Überleben des Volkes gesichert, wird weniger Nachwuchs erzeugt. »In der Baumhöhle schrumpft der Brutraum dann auf die Größe einer menschlichen Handfläche«, hat Torben Schiffer festgestellt. In der Imkerkiste wird der Brutraum stattdessen vergrößert. Dadurch entstehen unnatürlich große Völker. Und damit werden die Varroamilben regelrecht hochgepäppelt.
Ausgewilderte Völker
Vor einigen Jahren nun schon hat Torben Schiffer seinen Schiffertree entwickelt: eine künstliche Bienenbehausung, die eine natürliche Baumhöhle simuliert. Zehn Zentimeter dicke Holzwände, ein Innenraum von rund vierzig Litern Größe mit rauer Oberfläche, ein Einflugloch im unteren Bereich, damit im Winter möglichst wenig Wärme daraus entfleucht. Das Ganze zusammengehalten von eisernen Ringen und aufgehängt in Bäumen in etwa fünf Metern Höhe.

Dann haben Torben Schiffer und seine Mitstreiter vom gemeinnützigen Verein Beenature Bienenvölker aus den üblichen Imkerbeuten schwärmen lassen – und siehe: die Bienen sind bereitwillig in die nachgebildeten Baumhöhlen eingezogen. Das war zu erwarten, denn dazu gab es bereits Grundlagenforschung. Die stammt vom US-amerikanischen Verhaltensbiologen Thomas Dyer Seeley, der schwärmenden Bienen verschiedene Behausungen angeboten hatte. Die Bienen wählten immer Wohnungsgrößen mit etwa vierzig Litern Rauminhalt, auch wenn größere Räume angeboten wurden. Und sie wählten immer die Behausungen in der Höhe, also nicht auf dem Boden, wo die Imker ihre Bienenbeuten aufstellen.
»Die Bodennähe kann für Bienenvölker tödlich sein«, sagt Torben Schiffer, »denn der Boden ist bewohnt von Destruenten«, also von Zersetzern organischer Substanzen. »Zersetzen ist der Job der Bodenlebewesen. Damit schaffen sie die organische Substanz in den Boden und halten den fruchtbar.« Ein Bienenvolk, sein Wabenbau, sein Vorrat, ist aber komplett organisch. Also bauen die Bienen am liebsten in luftiger Höhe, weit weg von den Bodenlebewesen.
Der Schiffertree wäre also als nachgebaute Baumhöhle die ideale Behausung für ein Bienenvolk. Dennoch haben rund achtzig Prozent der Völker, die dort eingezogen sind, das erste Jahr nicht überlebt. Die engagierten Bienenforscher um Torben Schiffer waren entsetzt, hatten sie doch vermeintlich optimale Bedingungen geschaffen.
War es am Ende doch die Varroamilbe, die die Bienen umgebracht hatte. Sie war es nicht. Die meisten der ausgewilderten Bienenvölker waren schlicht nicht mehr in der Lage, unter natürlichen Bedingungen zu überleben. Die von den Bäumen geholten und auseinandergenommenen Schiffertrees zeigten, dass die meisten Völker nicht mehr wussten, wie sie ihre Waben selbst bauen sollten. Die in fertigen Wabenrähmchen aufgezogenen Zuchtbienen hatten den Wabenbau verlernt. Sie legten unten am Flugloch wirre Wabenzellen an, die im Winter auskühlten und ihre Erbauerinnen sterben ließen.
Ein regelrechter Wabenbau beginnt oben in der Wohnhöhle. Die Waben werden an der Decke angehängt und dann in nebeneinander liegenden Taschen nach unten gebaut. Dadurch entstehen Wärmespeicher, die die aufsteigende warme Luft auffangen. »Ein Bienenvolk, dass das nicht kann, wird von der Natur gnadenlos aussortiert«, sagt Torben Schiffer. Fünf Jahre nach der ersten Besiedelung der Schiffertrees, sind nun nur noch Bienenvölker dort zuhause, die ihren Wabenbau beherrschen.
»Die Imkerei aber züchtet Bienen weiter, die das verlernt haben, weil die vielleicht besonders fleißig sind oder besonders friedlich«, sagt Torben Schiffer. Beides Eigenschaften, die in der Natur eher kontraproduktiv sind. »Die Imkerei trägt zur Erosion des gesamten Genpools der Honigbiene bei, weil nicht überlebensfähiges Erbgut multipliziert wird, das den menschlichen Ansprüchen genügt, aber in der Natur keine Chance hat.«
Fleißige Bienen – faule Bienen
Torben Schiffer hat einen kleinen Beobachtungsversuch zum Fleiß der Bienen auf seinem Balkon durchgeführt. Dort stellte er eine normale Bienenkiste auf – eine der üblichen dünnwandigen Beuten mit den eingehängten Rähmchen. Und daneben einen der früher üblichen Bienenkörbe, eine gut isolierte aus dicken Strohseilen geflochtene Stöpe, in der die Bienen ihre Waben selber bauen müssen.
Seine Beobachtung des sehr unterschiedlichen Verhaltens der beiden Bienenvölker zeigt, wie ungünstig die Imkerkiste für die Bienen ist. Das Volk aus der Beute flog schon frühmorgens los und dann unaufhörlich bis zur Dämmerung. Vor der strohenen Stöpe aber am Morgen in der Frühe erstmal kein Flugbetrieb. Stattdessen saßen dort Bienen vor dem Flugloch, die sich gegenseitig befühlten. Sie vollführten das, was wir von den Affen kennen, sie pflegten sich: Grooming. Dann beobachtete er Bienen, die Schmutz aus der Behausung trugen, darunter auch totgebissene Wachsmotten. Die Bienen waren also nicht fauler als die nebenan in der Imkerkiste. Sie hatten nur Zeit, sich um sich selbst und ihr Haus zu kümmern.
Und warum passierte das in der Imkerkiste nicht? Die Antwort gibt die Wärmebildkamera: die dünnwandigen Imkerkisten sind eine energetische Katastrophe, sie müssen von den Bienen im Sommer mit Flügelschlag gekühlt, und im Winter mit Körperwärme beheizt werden. Und das viel heftiger als in einer Baumhöhle oder in einem der altertümlichen Strohkörbe.
Die Berechnung dazu stammt von Jürgen Tautz, dem Bienenprofessor, der das Geleitwort zu Torben Schiffers Buch geschrieben hat: In einer der üblichen Holzkisten muss ein Bienenvolk pro Jahr ungefähr dreihundert Kilo an Honig umsetzen. Etwa 250 Kilogramm davon gehen hauptsächlich für die Heizung drauf. Um ein Kilo Honig herzustellen, brauchen die Bienen aber die zwei- bis dreifache Menge an Nektar. Bei einem Umsatz von dreihundert Kilogramm Honig im Jahr, müssen die Bienen also bis zu neunhundert Kilogramm Nektar einfliegen.
Deshalb haben die Bienen in der Imkerkiste keine Zeit, sich die Varroamilben vom Körper zu klauben oder ihr Haus sauber zu halten. Sie müssen Nektar eintragen um Honig zu produzieren, von dem am Ende nur ein Sechstel als Ernte für den Imker bleibt, der das Entnommene dann auch noch mit Zuckerwasser kompensieren muss, damit seine Bienen durch den Winter kommen. In einer natürlichen oder nachgebauten Baumhöhle oder auch in einer der ehemals üblichen Strohkörbe brauchen die Bienen nur ein Zehntel.

Nektarsauger Honigbiene
So kommt es, dass die über eine Million Bienenvölker, die wir allein in Deutschland halten, am Ende die Landschaft leer machen. Nach den Untersuchungen von Tom Seeley in den USA, der sich in einem unserem mitteleuropäischen Klima entsprechenden Waldgebiet vierzig Jahre lang um wildlebende Honigvölker gekümmert hat, kann man von einer natürlichen Dichte von einem Bienenvolk pro Quadratkilometer ausgehen.
Bei einer solchen Bienenbevölkerungsdichte, rechnet Torben Schiffer, nutzt die Honigbiene etwa ein Prozent des Nektarangebots einer ausreichend diversen Blütenlandschaft. Die restlichen 99 Prozent bleiben für die anderen Blütenbesucher – Wildbienen und Schmetterlinge und Fliegen.
Ganz anders ist das in den Gebieten, die intensiv von Imkern mit ihren Nutzvölkern beharkt werden. Das Extrembeispiel ist Berlin mit seiner ausufernden Stadtimkerei. Dort kommen auf einen Quadratkilometer Stadtfläche bis zu zwanzig Bienenvölker. Jedes dieser Völker fliegt in einem Radius von etwa drei Kilometern, also auf einer Fläche von etwa 27 Quadratkilometern, hinein in die Standorte von wiederum je zwanzig Bienenvölkern pro Quadratkilometer, die wiederum ihren Radius von drei Kilometern absuchen. Wenn man diese schwindelig machende Rechnung zu Ende führt, sagt Torben Schiffer: »Dann bedeutet das, dass jeder Quadratmeter der Stadt von 560 von Imkern gehaltenen Bienenvölkern abgefrühstückt wird.«
Ähnlich ist es in den Gebieten, die von Wanderimkern besucht werden. Torben Schiffer würde wohl eher »heimgesucht« sagen. Da kommt einer mit einem Lastwagen und lädt achtzig Bienenvölker in der Heide ab, wenn die gerade blüht. Dann sammeln diese Völker die umliegenden Blüten leer, und wenn nichts mehr da ist, was sie eintragen könnten, lädt der Imker die Kisten wieder auf und fährt sie weiter zur nächsten Blütentracht. »Was soll da übrig bleiben für all die anderen Insekten?« fragt Torben Schiffer. Und wählt einen drastischen Vergleich: »Stellen Sie sich das mal in der Fischerei vor: Da schwimmen zwanzig Fischerboote auf einem Quadratkilometer Ostsee. Und jedes von denen hat ein Ringnetz unter sich von drei Kilometern Durchmesser. Überfischung wäre ein harmloser Ausdruck dafür, und verboten ist das auch. Nicht so in der Imkerei. Da kann jeder so viele Bienenvölker halten, wo und wie er will.«
Die Forderung des Bienenschützers Torben Schiffer zur Regulierung der Imkerei: Verbot der Zuckerfütterung von Nutzbienen. Das fordert er als Vorsitzender des Vereins Beenature, weil das die Imkerei begrenzen würde. Und diese Begrenzung wäre dringend nötig. »Ja, wir haben ein Pestizidproblem, ja, wir haben wenig insektenfreundliche Landschaften«, sagt Torben Schiffer. Aber auch die überbordende Imkerei sorge für Artensterben, weil sie nichts mehr übrig ließe für all die gefährdeten Wildbestäuber.
Und was heißt das jetzt? Kein Honig mehr? Ja, sagt der Artenschützer, der selber wildlebende Honigbienenvölker ansiedelt, jedenfalls nicht in den von uns konsumierten Mengen. Vielleicht zurück zum Luxusgut – wie das früher war, als die Bienen noch in gut isolierten Strohkörben gehalten wurden. Wenige Völker, so viele eben, wie die Landschaft ernähren konnte. Eine Idee aus den Zeiten, bevor Zucker industriell hergestellt werden konnte, bevor er so preiswert wurde, dass man die Bienen damit durch den Winter füttern kann.